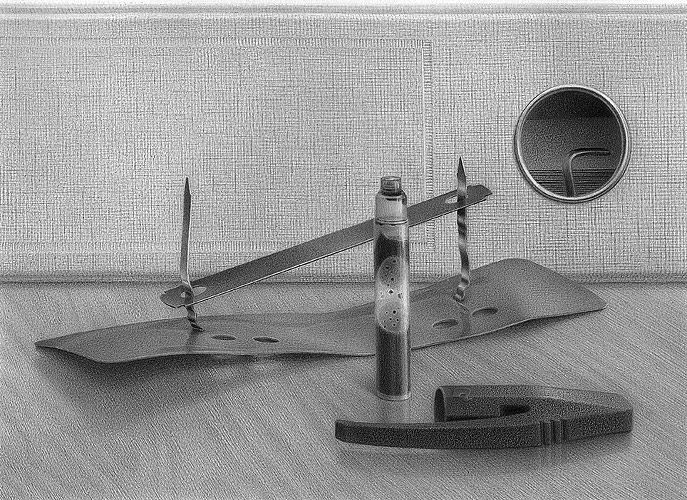
Porträts vom Menschen
Die Zeichnung, so sagt man, sei die
schnellste Verbindung zwischen Hirn
und Hand. Das trifft sicherlich für die
Ideenskizze zu, nicht jedoch für die
makellosen Zeichnungen von Astrid
Brandt. Sie sind klar komponiert,
stimmig in jedem Detail und genau
ausgearbeitet. Sorgsam inszenieren sie
Licht und Schatten. Für ihre Anfertigung
braucht es Zeit. Dabei geht der
Bleistift der Künstlerin mit der registrierenden
Präzision einer Fotokamera
zu Werke. Dennoch haben ihre
Bilder eine Handschriftlichkeit, die
jeden Gedanken an irgendeinen fotorealistischen
Ehrgeiz hinsichtlich der
Darstellung abweist. Bei allem Verismus
machen sie keinen Hehl daraus,
dass es ihnen um eine subjektive Auffassung
der Wirklichkeit geht. Sie
strömt aus jedem Strich der Bilder.
Aus ihrer Textur, ihrem Duktus, ihrer
Tonalität. Obwohl sie alle nur möglichen
Graustufen erfassen, die zwischen
den Polen Schwarz und Weiß
liegen, sind diese unbunten Zeichnungen
die farbigsten, die man sich
denken kann. Vielleicht so, wie man
das Grau in den Theatertücken von
Samuel Beckett als farbiges Leuchten
gerühmt hat.
Dass es der Künstlerin nicht um ein
objektives Registrieren geht, sondern
um eine subjektive Inszenierung machen
auch die Titel der Werke deutlich.
Obwohl ihre Bilder sich ausschließlich
der Dingwelt zuwenden,
finden sich immer wieder metaphorische
und ausdeutende Titel, nicht selten
auch solche die Personen nennen.
„Ginger & Fred“ (2006) ist so einer,
bei dem jeder Betrachter natürlich an
das weltberühmte Tanzpaar Fred
Astaire und Ginger Rogers denkt.
Vielleicht aber auch an den schönen
und bewegenden Film „Ginger e Fred“
des italienischen Regisseurs Federico
Fellini aus dem Jahr 1986, in dem er
seine, in vielen seiner Werke erprobten
Darsteller Giulietta Masina und
Marcello Mastroianni noch einmal als
altes Tanzpaar vor die Kamera holte.
Ihre Gegensätzlichkeit wie ihre Gleichgestimmtheit,
die sie in diesem Film
nicht nur im künstlerischen Tanz, sondern
auch im Kunstwerk eines gelingenden
Lebens zu verbinden wissen,
sind herzzerreißend.
Astrid Brandt macht all das in ihrem
Diptychon deutlich, dessen zwei Bilder
ebenso ähnlich wie unterschiedlich
sind. Sie zeigt auf ihnen zwei
unterschiedliche Entrées von Einfamilienhäusern.
Das eine ist großzügig,
glamourös und elegant, das andere
eher bieder, muskulös und solide. Sie
stehen für Ginger und Fred und repräsentieren
sie wie auch die unterschiedlichen
Textilien in den jeweiligen
Garderoben. Die Künstlerin
bedient sich bei ihren Zeichnungen
einer rhetorischen Figur, die wir als
Metonymie kennen. Dabei werden die
Häuser und Kleider zu Porträts ihrer
abwesenden Bewohner.
Eine ganz ähnliche Aufgabe übernehmen
die im Format vergrößerten
Dinge in ihrer Werkserie der „Büropartikel“
(2011). Dort zeigt Astrid
Brandt in einer Zeichnung, die wie
immer akribisch ausgeführt ist, vor
dem Rücken eines liegenden Aktenordners
eine eingetrocknete Tintenpatrone,
eine einsame Kugelschrei -
berkappe und einen verdrehten Hefter.
Eine Art Stillleben. Ganz wörtlich
so, denn die Dinge in diesem Bild sind
still gestellt und ohne Leben. Es trägt
den bezeichnenden Titel „Limbo“
(2011), was in christlichem Verständnis
wie auch in der Vorstellung Dantes
in seiner „Göttlichen Komödie“
eine Art Vorhölle für die unerlösten
Seelen ist. Bei Dante ist es der angemessene
Ort für alle, die in ihrem
Leben ohne Glauben waren und sich
nur von reinem Zweckdenken leiten
ließen. „Limbo“ gibt den Ton vor für
alle „Büropartikel“.
Ganz ähnlich in Stimmung und Anmutung
sind in „Display“ (2011) die
dem Blick des Betrachters zugewandten
Rücken zweier aufrecht stehender
Aktenordner, davor ein an- gebrochenes
Streichholzheftchen und
ein offenes Pappkästchen mit Deckel.
Oder das Ensemble von Aktenordner
und Tesafilmrolle, weißem Einkaufswagenchip
und Karteikartenkasten in
„Compilation“ (2011). Sie alle stehen
in ihrer puristischen und völlig makellosen,
ebenso unbenutzten wie zugleich
abgelebten Faktur für eine
bürokratische Welt.
Auch hier vertreten die Dinge ihre abwesenden
Benutzer und sind deren
Statthalter. Schaut man auf sie, fällt
einem wahlweise Herman Melvilles
Kanzleidiener „Bartleby“ ein, mit seinem
berühmten Verweigerungssatz
„I would prefer not to.“ oder Franz
Kafkas „Prozess“ mit seinen unheimlichen
und undurchschaubaren Urteilen
oder der französische Philosoph
Jean Paul Sartre, für den die Mitmenschen
schon im Normalzustand
die Hölle waren („L’enfer, c’est les
autres“), um wie viel mehr erst im
Räderwerk einer bürokratisch organisierten
Verwaltung.
Michael Stoeber
__________________________________________________________________________
Astrid Brandt
geboren 1963 in Bremen,
lebt und arbeitet in Wilhelmshaven und Braunschweig
